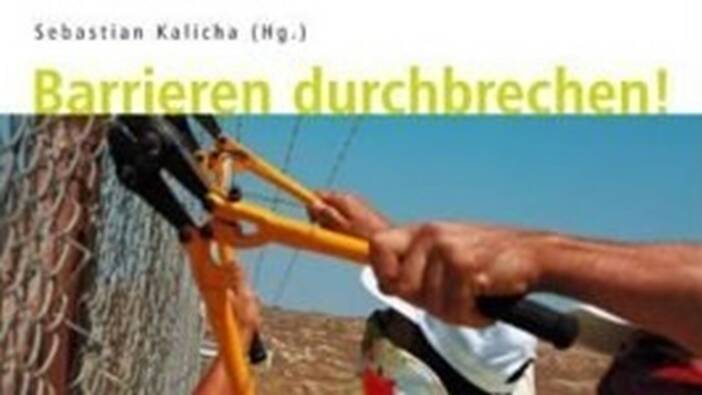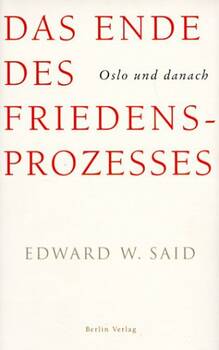
International bekannt geworden ist der 1935 in Jerusalem geborene Edward Said durch Werke wie Orientalismus (1978) und Kultur und Imperialismus (1993). Als US-amerikanischer Literaturwissenschaftler und -kritiker palästinensischer Herkunft gehörte Said nicht nur zu den bekanntesten Intellektuellen seiner Zeit, sondern auch zu den prominentesten Kritikern des Osloer Friedensprozesses. Seine in den 1990er Jahren zumeist in den arabischen Zeitungen Al-Ahram Weekly und Al-Hayat erschienenen politischen Interventionen zum Nah-Ost-Konflikt sind im Jahre 2002, ein Jahr vor seinem frühen Tod, im Berlin-Verlag erschienen und bieten eine ebenso engagierte wie scharfsinnige Kommentierung der damals ablaufenden Prozesse.
Getragen von seiner expliziten Überzeugung, dass die einzige Hoffnung für das israelische wie das palästinensische Volk in einer vernünftigen und gerechten Koexistenz beider Völker auf der Grundlage von Gleichheit und Selbstbestimmung liege, stellt Said verbittert fest, dass der Osloer Friedensprozess einen von Beginn an «unvermeidlichen Verlauf» und «absehbaren Ausgang» genommen habe, weil er kein gleichberechtigter Friede gewesen und die entscheidenden Fragen dieses jahrzehntelangen Konfliktes mit ihm nicht beantwortet worden seien. Die palästinensische Seite hätte vielmehr die Enteignungen und Vertreibungen von 1948 und 1967 akzeptieren müssen, um eine Autonomie zu erlangen, die beschränkt zu nennen noch milde ausgedrückt ist. Auch weiterhin, schreibt er bspw. im August 2001, würden die Israelis im formell autonomen Palästina nicht nur große Teile des Landes kontrollieren, sondern auch die staatlichen Sicherheitsbelange und Grenzen sowie die gesamte Wasserversorgung. Auch der rein militärische Machtunterschied «ist so gewaltig, dass es zum Weinen ist. Ausgerüstet mit den neuesten amerikanischen (und großzügig überlassenen) Kampfjets, mit Kampfhubschraubern, unzähligen Panzern und Raketen, einer hervorragenden Flotte sowie einem modernst ausgestatteten Geheimdienst, misshandelt die Atommacht Israel ein Volk, das weder über Panzerfahrzeuge oder Artillerie, Luftwaffe (sein einziger jämmerlicher Flugplatz in Gaza wird von Israel kontrolliert [und wurde kurze Zeit später zerstört; CJ]), Flotte oder Armee noch über die Institutionen eines modernen Staates verfügt.» (S. 292)
Die Reisefreiheit der Palästinenser sei grundlegend eingeschränkt, ihre Landwirtschaft und Wohnsiedlungen würden gezielt zerstört, große Teile ihrer Bevölkerung auch weiterhin gettoisiert. Ökonomisch und sozial abgeschnitten, liege die Arbeitslosigkeit bei 60 Prozent, die Armut bei 50 Prozent. Die Frage der Stellung Jerusalems, das Rückkehrrecht der Flüchtlinge, die andauernde und systematisch verstärkte israelische Siedlungspolitik auf palästinensischem Gebiet, die Frage der Grenzen und der Souveränität, alle diese zentralen Fragen seien bisher nicht gelöst worden: «In jeder wichtigen Frage, die Palästinenser von Israelis trennt, waren es die Palästinenser, die nachgegeben haben.» (S. 232) Die auf Ausgrenzung und Vertreibung der Palästinenser zielende zionistische Ideologie sei auch weiterhin Leitbild der israelischen Politik und setze, so Said im August 1997, eine «erschreckende Spirale von Verlust und Demütigung» (S. 132) in Gang.
Trotz prinzipieller Sympathie und Solidarität mit der palästinensischen Sache spart Said in seinen Beiträgen nicht mit Kritik an der palästinensischen Opposition, die es allzu oft an Glaubwürdigkeit und wirklicher Besserung vermissen lasse. Von den islamistischen Fundamentalisten hält Said ebenso wenig wie von der palästinensischen Autonomiebehörde (PA) unter Arafat. Die PA sei eine undemokratische polizeistaatliche Autokratie, korrupt und autoritätshörig gegen die USA: «Solange Arafat und Konsorten am Ruder sind, besteht keine Hoffnung.» (S. 297) Saids Hoffnung war eine neue Generation säkularer Palästinenser, die sich sowohl gegen die alte, ebenso unfähige wie kleinmütige PLO-Führung wie auch gegen die islamistisch-fundamentalistische Opposition wenden sollte. Deren Selbstmordattentate hält er für «menschlich verständlich», aber «moralisch nicht zu entschuldigen» (S. 140). Politisch gesehen seien sie schlicht «inakzeptabel»: «Es besteht ein gewaltiger Unterschied zwischen organisiertem Ungehorsam oder Massenprotest und der Taktik, sich und ein paar Unschuldige in die Luft zu jagen.» (S. 273)
Hoffend auf eine schweigende Mehrheit von unangepassten, nicht korrupten Palästinensern, die jenseits von Jassir Arafat und Mahmud Abbas, aber auch fern ab des Islamismus in der Lage sei, eine neue säkulare nationalistische Strömung zu begründen, setzt Said auf ein Ende der Besatzung, auf die Demokratisierung und eine historische Aussöhnung mit den Israelis:
«Wir müssen unsere Geschichte zusammen denken, so schwierig das sein mag, damit es eine gemeinsame Zukunft geben kann. Und diese Zukunft muss Araber und Juden in gleicher Weise einschließen, frei von allen Vorstellungen, die darauf abzielen, die eine oder andere Seite zu missachten oder theoretisch oder politisch auszuschließen. Darin liegt die eigentliche Aufgabe. Der Rest ist dann vergleichsweise einfach.» (S. 154 f.)
Als Zielvorstellung plädierte er für einen binationalen, demokratischen Staat, sah allerdings auch damals noch keine Alternative zu einer vorübergehenden staatlichen Teilung. Doch auch diese müsse eine wesentlich demokratische sein, mit gleichen Rechten für alle Bürger: «Selbstbestimmung und gleiche Rechte für beide Völker. Keine Besatzung, keine Diskriminierung, keine Siedlungen. Jeder wird mit einbezogen.» (S. 273). Politische Trennung sei allenfalls eine Notlösung, die Teilung «ein Erbe des Imperialismus». Man müsse endlich anfangen, wirklich in Begriffen von Koexistenz zu denken, «nach der Teilung, trotz der Teilung» (S. 227)
Doch nicht diese (zumindest damals noch) politisch sicherlich konsensfähige politische Strategie macht das Buch Saids zu einem wichtigen Werk des verfahrenen Nahost-Konfliktes. Es sind vor allem seine Beschreibungen und Darstellungen des palästinensischen Besatzungsalltags, der israelischen Befindlichkeiten und Taten sowie seine Analysen der politischen Tagesereignisse, die das Buch (trotz seines Prinzips Hoffnung) zu einer traurig-pessimistischen Chronik des Verfalls macht. Und mit steigendem Abstand zu ihrer Entstehung bekommen jene damals noch vermeintlich nebensächlichen Passagen stärkere Bedeutung, in denen Said die immer weiter auseinanderklaffende Rhetorik und Wirklichkeit jenes Friedensprozesses registriert, der, wie er in der Einleitung schreibt, «nicht zu einem wirklichen Frieden führen kann, mit einiger Wahrscheinlichkeit auch nicht in der Zukunft» (S. 8).
Edward Said: Das Ende des Friedensprozesses. Oslo und danach, Berlin 2002: Berlin-Verlag (320 S., 9,95 €).